Schon mal was von einem Sportbürger gehört?
Alba Berlin ist einer der erfolgreichsten deutschen Sportvereine. Aber dem Club reicht das nicht. Weil sie dort glauben, dass man mit Sport mehr erreichen kann als Titel.Von Tammo Blomberg und Christian Spiller • Fotografie: Anna Tiessen
25. Mai 2024, 15:00 Uhr
Muazzez hat Cookies, Eistee und Lebkuchen auf den Küchentisch ihrer Wohnung in der Berliner Gropiusstadt gestellt, aber sie selbst rührt davon nichts an. Es gibt zu viel zu erzählen: über ihren Weg von Istanbul nach Berlin, über Basketball und ihre Tochter.
Die heißt Mira, ist elf Jahre alt und kauert etwas ausgelaugt auf dem Stuhl neben ihr, eine Collegejacke über dem gelben Trainingsshirt, mit dem sie vorhin durch die Trainingshalle geflitzt ist. An der Wand im Wohnzimmer kleben die Buchstaben H-O-M-E, eine Wanduhr ersetzt das O. Auf dem Teppich stehen die Buchstaben gleich noch mal. Als wollte jemand jeden Zweifel daran verjagen, dass dies wirklich ihr Zuhause ist, der neue Lebensmittelpunkt der Familie.
Muazzez sagt, sie sei für ihre Kinder nach Deutschland gekommen; für Mira und ihren älteren Bruder. Deren Perspektive sei hier besser als in der Türkei. Weil sie neben der türkischen auch die bulgarische Staatsbürgerschaft hat, konnte sie mit ihren Kindern in die EU einwandern. 2022 zogen die drei nach Berlin. Obwohl sie den Vater zurücklassen mussten, der sich in Istanbul weiter um seine Druckerei kümmert und einmal im Monat herfliegt. Und obwohl Muazzez wusste, wie herausfordernd das alles zunächst sein würde. Erst recht für ein zehnjähriges Mädchen.
"Everything was upside down", sagt Muazzez. Sie spricht Englisch, noch ist ihr Deutsch nicht so gut wie das ihrer Tochter. "Die Schule war neu, sie hatte keine Freunde hier, das Wetter war anders, sie konnte auf einmal ihre Gefühle nicht mehr ausdrücken."
So war die Lage, als ein Basketballtrainer von Alba Berlin für ein Schnuppertraining an Miras Schule kam. Und ihr hinterher vorschlug, mit dem Sport anzufangen. Mira musste sich entscheiden, ob sie lieber schwimmen wollte, wie ihr Bruder – oder Basketball spielen. "Ich spiele gerne mit anderen", sagt Mira. "Ich mag es nicht, alleine zu sein." Also Basketball.
Von da an musste sie sich vor dem Passen und Werfen, beim Bälle fangen und Zurücksprinten mit ihren Mitspielerinnen abstimmen. Im Bus auf dem Weg zu Spielen fing sie an, mit den anderen Mädchen zu reden; hinterher teilte sie die Wut über Niederlagen mit ihnen und das Hochgefühl nach Siegen. Sie begann, sich über gegnerische Fouls zu beschweren und Scherze über ihren Trainer zu machen.
Ohne Basketball wäre ihre Tochter nicht so gut angedockt in Berlin, da ist sich Muazzez sicher. Sie käme nicht so gut zurecht in der Schule, wäre weniger selbstbewusst und ausgelastet, sie würde die Sprache schlechter sprechen. Und toleranter sei sie auch geworden. "Ich glaube, sie versteht die Logik hinter Basketball", sagt Muazzez. "Es ist ein Mannschaftsspiel, es wird von allen geteilt, jeder muss etwas tun."
Großes Glück hätten sie gehabt, das sagt Miras Mutter immer wieder. Wobei: "Vielleicht hat es auch nichts mit Glück zu tun, sondern mit dem Programm."
Etwas mehr als anderthalb Jahre ist es her, dass Mira Istanbul verlassen hat. Und fast genauso lange spielt sie hier Basketball. Nicht irgendwo, sondern bei Alba Berlin, dem besten deutschen Basketballclub der vergangenen Jahre.
Kein Verein im Basketball hat den deutschen Pokal öfter gewonnen als Alba; die Meisterschaft holte nur Bayer Leverkusen häufiger, das mittlerweile aber in die dritte Liga abgesackt ist. Ab 2020 wurde Alba dreimal in Folge Meister, obwohl der größte Rivale Bayern München deutlich mehr Geld zur Verfügung hatte. Und auch Albas Frauenteam, das erst vor zwei Jahren in die Bundesliga aufstieg, hat in diesem Jahr seine erste Meisterschaft gewonnen. Kein anderer deutscher Basketballverein stellt derzeit bei den Frauen und den Männern ein Spitzenteam. Es gibt überhaupt im deutschen Mannschaftssport nicht so viele erfolgreichere Clubs.
"Warum nehmen wir nicht Kunst, Sport und Musik in den Fokus?"Vielen Proficlubs würde das reichen: erfolgreich sein. Stars produzieren, Unterhaltung liefern, vielleicht auch Inspiration. Gerne auch Geld verdienen. Alba Berlin reicht das nicht. Der Club soll mehr leisten. Er soll auch ausbilden, erziehen, Sozialarbeit leisten. Er soll integrieren und Chancengerechtigkeit ermöglichen, soll demokratische Werte lehren. Viele der größten und erfolgreichen Clubs dieses Landes, zumindest im Fußball, wirken, als hätten sie und ihre reichen Profis sich von der Basis entfremdet. Alba Berlin möchte im Kern eine Aufgabe miterledigen, die sonst vor allem den vielen kleinen Dorfvereinen zugeschrieben wird: das Land zusammenhalten.
Die beiden Männer, die diesen Verein vor allem ausmachen, sitzen sich an einem Freitagabend in einer Berliner Tapasbar gegenüber. Zwischen ihnen steht ein Teller mit Vorspeisen und die Frage, wer Alba Berlin zu dem Club gemacht hat, der er ist.
"Das ist dein Verein", sagt Henning Harnisch.
"Das ist dein Verein!", sagt Marco Baldi.
Baldi, 62, Geschäftsführer, ist der Mann, der Alba Berlin aufgebaut hat. Wenn er über Sport spricht, nutzt er zwei unterschiedliche Definitionen: Sport als unterhaltendes Element, das die Massen bewegt und ihm die Arena füllt. Und Sport als Vermittler von Werten, als bildendes Element. Das eine gilt traditionell als Aufgabe des Breitensports, das andere als Kraft des Spitzensports.
Bei Alba haben sie im Lauf der Jahre festgestellt, dass sie beides machen möchten. Und dass ihnen womöglich sogar zugutekommt, wenn sie beides machen; den Sport als Ganzes betreiben. Nicht so, dass das eine für das andere da ist. Sondern so, dass beides füreinander funktioniert.
Als Baldi 1990 aus dem Stuttgarter Umland nach Berlin kam, um die Überbleibsel der BG Charlottenburg zu einem neuen Club zusammenzusetzen, begann er damit, talentierte Köpfe aus dem Basketball herzulocken. Wie Svetislav Pešić, der Deutschland 1993 als Trainer zum Europameister gemacht hatte. Oder Henning Harnisch, der unter Pešić Europameister und mit Bayer Leverkusen siebenmal in Folge deutscher Meister geworden war.
Jeden Sommer rief Baldi damals bei Harnisch in Leverkusen an und fragte, ob er nicht auch nach Berlin kommen wolle. 1996, im ersten Sommer, in dem Baldi nicht von sich aus angerufen hatte, sagte Harnisch zu. Ein Jahr später wurde Alba erstmals Deutscher Meister.
"Henning ist im Prinzip ein Genie", sagt Baldi. "Ein Genie im Sinne von: Der hat einfach Ideen." Als die beiden im Sommer 2004 mal wieder nach dem Saisonende zusammensaßen, um Weizenbier zu trinken und über Basketball zu sprechen, begann Harnisch, der zu jener Zeit längst Kulturwissenschaftler und kein aktiver Leistungssportler mehr war, über den Club zu schimpfen. Der Kader, die Spielweise, das passe nicht zu Alba.
Baldi, so erzählt er das heute, nutzte den Moment, um dem Genie zu sagen: Mach hier doch einfach selbst mit. Und Harnisch machte mit.
Henning Harnisch, heute 56 Jahre alt und Vizepräsident von Alba, findet seine Ideen oft naheliegend. Ihn stört eher, dass sonst niemand darauf kommt. "Sport ist ein starres, konservatives Feld", sagt er. "Wenn man da was anders macht, wirkt das gleich wie eine crazy Idee, obwohl es nur was Kleines, Klares ist."
Harnisch hat für seine Ideen einen Begriff ersonnen: Die Kinder sollen Sportbürgerinnen werden.
Sportbürgertum, das heißt: Der Sport soll ein Teil der eigenen Identität werden. Weil die Kraft des Sports, gerade des Mannschaftssports, so gewaltig sei, dass er jeden und jede bereichert. Die Gesellschaft erst recht. Sport fördere die Gesundheit, das Miteinander, die Kreativität, zählt Harnisch auf. "Ich finde es sehr interessant, wie wenige Leute das – obwohl sie es selbst erfahren haben – ernst nehmen als Grundlage für gesellschaftliches Miteinander. Warum nehmen wir nicht Sport, Kunst und Musik in den Fokus und bauen daraus eine Bildungsidee?"
Die Sportbürger-RechnungDeshalb schicken Harnisch und Baldi seit Jahren Basketballtrainer von Alba Berlin an die Schulen der Stadt. Sie wollen Sport im System und in den Stadtteilen verankern, an Kitas und Schulen, den Orten, wo sich die Kinder ohnehin aufhalten. Vor allem in Berlin, aber auch darüber hinaus. Sie sind bei Alba ja nicht die Einzigen, die so denken. Es gibt Proficlubs, die ähnliche Programme für die Basis entwickeln, teils in Kooperation mit Alba. Die Gropiusstadt in Neukölln ist zum Musterstadtteil für das Programm "Sport vernetzt" geworden, an dem sich Clubs in ganz Deutschland beteiligen. Kleine, wie der TTV Neustadt an der Aisch. Oder große, wie Werder Bremen.
"Wär' doch geil, wenn alle das machen", sagt Henning Harnisch.
Viele Kinder in Deutschland bewegen sich zu wenig. In vielen Haushalten werden sie vor Bildschirme gesetzt, statt auf den Sportplatz geschickt; an vielen Schulen steht nicht Sport im Fokus, sondern Fächer, die relevant für den Pisa-Test sind. Und zugleich geht vielen Sportvereinen der Nachwuchs aus.
Wenn Vereine also direkt in die Kieze, Kitas und Schulen gehen, statt darauf zu vertrauen, dass die Kinder zu ihnen kommen, hilft das theoretisch allen. Den Lehrerinnen, die von professionellen Trainern entlastet werden. Den Vereinen, die Jungsportler ausbilden können. Und den Kindern und ihren Eltern sowieso. Erst recht in Brennpunkten wie der Gropiusstadt, wo die Kinderarmut hoch ist; knapp die Hälfte der Kinder lebt in Haushalten, die Transferleistungen beziehen. Wer hier aufwächst, hat mit höherer Wahrscheinlichkeit Sprachdefizite oder Übergewicht als im Berliner Durchschnitt. Und weil in solchen Brennpunktstadtteilen oft weniger Vereinssport angeboten wird, sind Albas Angebote und Schnuppertrainings hier noch wertvoller als anderswo.
In Gropiusstadt liegt deshalb ein Schwerpunkt des Programms. Aber neben der U12-Mädchenmannschaft in Gropiusstadt, in der Mira spielt, gibt es auch die U-12-Mädchen von Alba Hausburg, Alba Kollwitz, Alba Falkplatz oder Alba Weißensee. Mit insgesamt 90 Schulen und 50 Kitas arbeitet Alba in Berlin zusammen, baut Schulteams auf und organisiert AGs, oft auch gemeinsam mit kleineren Vereinen.
In der halben Stadt wuseln nachmittags Kinder in gelben Shirts durch die Hallen. Und je mehr Kinder durch die Hallen wuseln, desto größer ist die Chance, dass ein paar besonders begabte junge Basketballer darunter sind.
Henning Harnisch hat dafür eine Rechnung aufgestellt: Wenn 1.000 Kinder Basketball spielen, sollen 999 davon Sportbürgerinnen werden; die Werte des Mannschaftssports vermittelt bekommen und möglichst lange sportlich und gesund bleiben. Und eins von ihnen wird Profi. Am besten natürlich bei Alba. In dem Team, das Harnisch den "Leuchtturm einer Erzählung" nennt.
Dort spielt zum Beispiel Malte Delow. Delow, 23, wurde 2023 zum besten Nachwuchsspieler der Bundesliga gewählt; gerade hat er seinen Vertrag in Berlin bis 2027 verlängert. Als er bei Alba anfing, war er so alt wie Mira heute. Er wuchs am Berliner Stadtrand auf, durchlief das ganze Jugendprogramm. Der Spaß an der Bewegung, den Alba an Kitas und Schulen vermittle, finde sich auch im Spielstil wieder, erzählt er am Rande eines Trainings der Profimannschaft. Und im Bestfall lässt sich der Spaß am freien Spiel in Erfolg übersetzen.
Nicht immer funktionierte das in dieser Saison so selbstverständlich wie in manchen der vergangenen Jahre. Das Profiteam der Männer musste sich 2023 neu organisieren, weil viele prägende Leute den Verein verließen: der Weltmeister Maodo Lô; Jaleen Smith, ein ehemaliger MVP der Bundesliga. Oder Luke Sikma, der wie kaum ein anderer für die Berliner Spielweise stand: für klugen, unterhaltsamen Basketball, mit vielen Pässen und Entscheidungen, die den Gegner falsch erwischten. "Read and react", sagen Basketballfans dazu. Statt strikt nach Plan anzugreifen, braucht es Einfallsreichtum. Und Eingespieltheit, Vertrauen. Das Gefühl dafür, den Flow, das müsse man nach dem Abschied von Leuten wie Sikma erst wiederherstellen, sagt Malte Delow.
Oft werden sie bei Alba dafür gelobt, Spieler zu entwickeln. Auswärtige wie Johannes Thiemann, der 2018 nach Berlin kam, im vergangenen Sommer mit Deutschland Weltmeister wurde und mittlerweile das Gesicht der Alba-Mannschaft ist. Er glaube nicht, dass er sich woanders auch so entwickelt hätte wie in Berlin, sagt Thiemann bei einem Gespräch in Albas Trainingshalle. Und natürlich Jugendspieler; solche wie Malte Delow und Tim Schneider, der erst 26 Jahre alt ist und schon mehr als 400 Spiele für Alba gemacht hat. Oder Niels Giffey. Giffey ist Berliner durch und durch; er wurde in der Hauptstadt geboren, seine Tante war Regierende Bürgermeisterin, Alba machte ihn zum Basketballer. Mittlerweile trägt er das weinrote Trikot der Rivalen. Das des FC Bayern.
In München sei mehr Erfahrung, sagt Giffey, als er nach einem Auswärtsspiel der Bayern in Berlin vor der Kabine seines Teams steht. Bei Alba gehe es mehr um Entwicklung, da bekämen junge Spieler eher eine Chance. Und das passlastige System, das sei besonders in Berlin. Selbst in der Euroleague, der europäischen Superliga des Basketballs, falle ihm auf, wie viel Alba den Ball von einem Spieler zum anderen bewege.
Vielleicht hat Alba gerade rechtzeitig genug Flow gefundenIn der Bundesliga verlor Alba mit diesem System zwar auch in dieser Saison nicht viele Spiele, aber schon etwas mehr als in den Vorjahren. Vor allem im ersten Drittel der Saison. Am Ende aber gingen sie als Zweiter in die Play-offs, die am vergangenen Freitag begannen, nur einen Sieg hinter den Bayern. Die erste Runde gegen den Vorjahresfinalisten Bonn gewannen sie mit 3:0, es war der einzige glatte Sieg einer Mannschaft in der ersten Runde.
Auch wenn der große Favorit Bayern München heißt, in diesem Jahr vielleicht noch mehr als in den Vorjahren: Es scheint, als habe Alba rechtzeitig genug Flow für den Meisterschaftskampf gefunden. Trotz des Umbruchs und der vielen Verletzungen. Mitte Mai, im vorletzten Spiel der Saison, konnten sie die Münchener Rivalen nach zuvor drei Niederlagen in Folge zum ersten Mal in dieser Saison besiegen. Gut eine Woche, nachdem die Frauen ihre erste Meisterschaft gewannen. Da standen die Männer am Rand und beklatschten ihre neuerdings so erfolgreichen Kolleginnen.
Klar hätte er gerne mehr Geld zur Verfügung als die Bayern, sagt Marco Baldi. Nicht, dass sie keins hätten in Berlin, deutlich mehr jedenfalls als viele andere deutsche Vereine, die Münchener ausgenommen. Aber in der Euroleague, unter den Besten in Europa, ist das anders; da sind sie kaum konkurrenzfähig. Fünf Spiele hat Alba in Europa in dieser Saison gewonnen, 29 verloren. Am Ende waren sie Tabellenletzter; abgeschlagen. Und einfacher dürfte es nicht werden in der Euroleague, die darüber nachdenkt, sich für Geld und Teilnehmer aus den Golfstaaten zu öffnen.
Alba muss sich also anders helfen. Mit dem eigenen Standort, mit der Stadt als Ressource. Denn woran es in Berlin nicht mangelt, sind Menschen, die man dazu bringen kann, Basketball zu spielen.
In der Schulturnhalle in Neukölln, wo Miras Mannschaft trainiert, hat ihr Trainer Luca Eisen Hütchen aufgestellt, Bälle ausgelegt und Reifen platziert. Eine Jungbasketballerin nach der anderen tritt durch die Tür, bückt sich nach einem Ball und beginnt zu dribbeln. Das Quietschen der Schuhsohlen auf dem Linoleum wird mit jedem Mädchen lauter.
Luca Eisen sagt, es gehe ihm nicht direkt darum, Leistungssportlerinnen zu formen. Er orientiert sich an Henning Harnischs Sportbürger-Gleichung. Während er erzählt, tritt ein Mädchen heran und präsentiert ihm ihr Trikot von Maodo Lô, samt Unterschriften von Alba-Spielern. Ein anderes fragt ihn, wann endlich ihr gelbes T-Shirt ankommt, bedruckt mit ihrem Namen. Wer hier am Ende nicht bei den Profis von Alba Berlin landet, steht vermutlich zumindest auf der Tribüne. Um denen zuzujubeln, die es geschafft haben.
Das Ideal des Sportbürgertums mag einerseits Selbstzweck sein, weil Harnisch, Baldi und die Menschen um sie herum von der Kraft des Sports und von dessen Werten überzeugt sind. Und trotzdem ist es natürlich mehr als ein netter Nebeneffekt, dass Albas Programm auch Profis produziert. Es ist elementar: Für die Qualität und die Identität der Profimannschaft, für den Sportdirektor, der weniger Geld für Spieler ausgeben muss. Auch für die Jugendtrainer, die es antreibt, wenn einer ihrer Schützlinge es bis nach oben schafft.
"Bei aller Sozialarbeit, bei aller gesellschaftlichen Verbindung: Wir sind gleichzeitig in einem wahnsinnigen Wettbewerb unterwegs", sagt Marco Baldi.
Es war nicht immer klar, dass die Idee aufgeht; dass beides nebeneinander – oder füreinander – funktionieren kann. Aber es geht. Anfang des Jahres war Baldi mit ein paar Mitarbeitern in Orlando, zu Besuch bei den NBA-Stars Franz und Moritz Wagner, die bei Alba groß wurden. Stars, die wiederum dabei helfen, die Kleinen zu motivieren. Der Name lockt an, das Logo, das Trikot. Der Glanz des Erfolgs.
In Miras Zimmer liegt ein großes Poster des Frauenteams. Sie bewundert Lucy Reuß, die Wurfspezialistin, die schon seit 10 Jahren im Verein ist. Wobei, sagt sie, sie selbst nicht unbedingt Basketballerin werden wolle. Ärztin vielleicht.
 https://www.zeit.de/sport/2024-05/alba- ... ettansicht
https://www.zeit.de/sport/2024-05/alba- ... ettansicht 

 | Berlin-Marathon Jubilee
| Berlin-Marathon Jubilee 


 | Berlin-Marathon Jubilee
| Berlin-Marathon Jubilee 





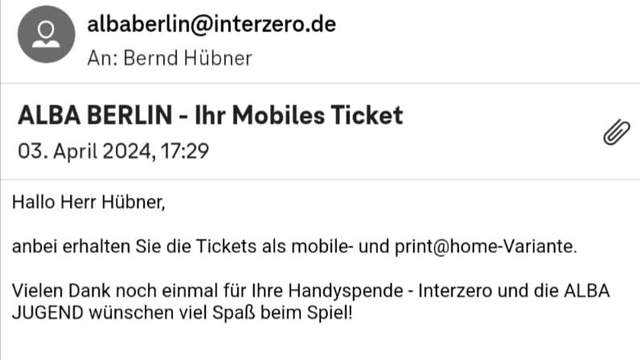
 | Berlin-Marathon Jubilee
| Berlin-Marathon Jubilee 








 | Berlin-Marathon Jubilee
| Berlin-Marathon Jubilee 



 | Berlin-Marathon Jubilee
| Berlin-Marathon Jubilee 


 | Berlin-Marathon Jubilee
| Berlin-Marathon Jubilee 









 | Berlin-Marathon Jubilee
| Berlin-Marathon Jubilee 



 | Berlin-Marathon Jubilee
| Berlin-Marathon Jubilee 


 | Berlin-Marathon Jubilee
| Berlin-Marathon Jubilee 












 | Berlin-Marathon Jubilee
| Berlin-Marathon Jubilee 

